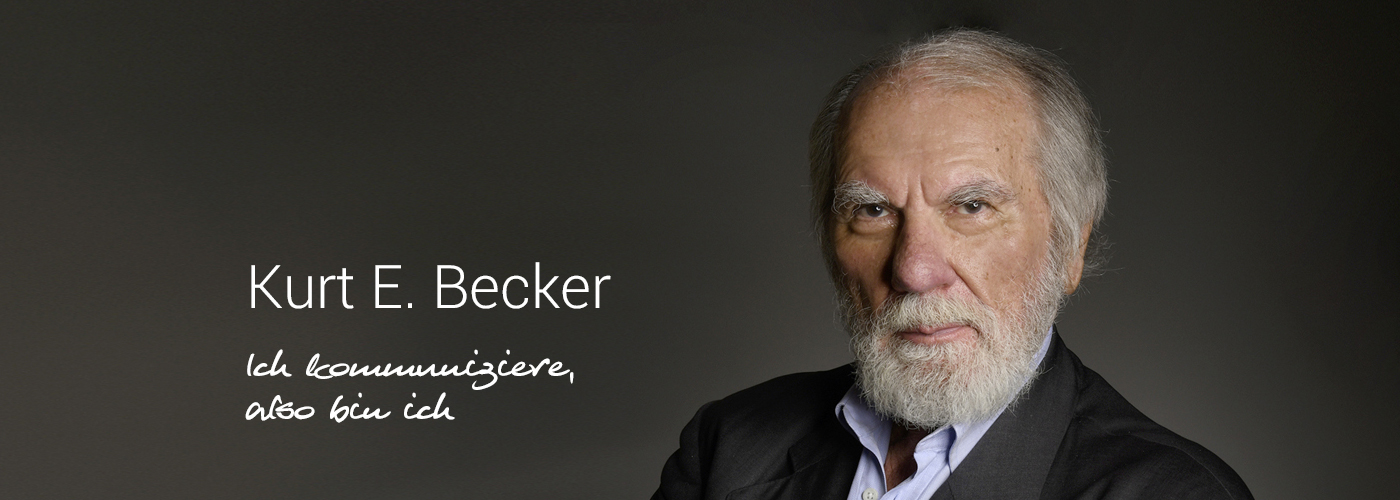„Die Stadt ist die komplizierteste Gestaltung menschlichen Zusammenlebens“
Unser Wille, zu sein
Kurt E. Becker im Gespräch mit Wolfgang Borchert
KEB: Herr Borchert, lassen Sie uns über Hamburg, Ihre Heimatstadt, miteinander sprechen.
Borchert: Hamburg! Das ist mehr als ein Haufen Steine, Dächer, Fenster, Tapeten, Betten, Straßen, Brücken und Laternen. Das ist mehr als Fabrikschornsteine und Autogehupe – mehr als Möwengelächter, Straßenbahnschrei und das Donnern der Eisenbahnen – das ist mehr als Schiffssirenen, kreischende Kräne, Flüche und Tanzmusik – oh, das ist unendlich viel mehr.
KEB: Was also genau ist Ihnen Hamburg?
Borchert: Das ist unser Wille, zu sein. Nicht irgendwo und irgendwie zu sein, sondern hier und nur hier zwischen Alsterbach und Elbestrom zu sein – und nur zu sein, wie wir sind, wir in Hamburg. Das geben wir zu, ohne uns zu schämen: Daß uns die Seewinde und die Stromnebel betört und behext haben, zu bleiben – hierzubleiben, hier zu bleiben! Dass uns der Alsterteich verführt hat, unsere Häuser reich und ringsherum zu bauen – und daß uns der Strom, der breite graue Strom verführt hat, unserer Sehnsucht nach den Meeren nachzusegeln, auszufahren, wegzuwandern, fortzuwehen – zu segeln, um wiederzukehren, wiederzukehren, krank und klein vor Heimweh nach unserm kleinen blauen Teich inmitten der grünhelmigen Türme und grauroten Dächer.
KEB: Das ist nicht nur eine ganz besondere Bindung, die Sie an Hamburg hegen. Das ist eine wunderbare Beschreibung besonderen Sich-behaust-Fühlens.
Borchert: Hamburg, Stadt: Steinwald aus Türmen, Laternen und sechsstöckigen Häusern; Steinwald, dessen Pflastersteine einen Waldboden mit singendem Rhythmus hinzaubern, auf dem du selbst noch die Schritte der Gestorbenen hörst, nachts manchmal. Stadt: Urtier, raufend und schnaufend, Urtier aus Höfen, Glas und Seufzern, Tränen, Parks und Lustschreien – Urtier mit blinkenden Augen im Sonnenlicht: silbrigen, öligen Fleeten! Urtier mit schimmernden Augen im Mondlicht: zittrigen, glimmernden Lampen! Stadt: Heimat, Himmel, Heimkehr – Geliebte zwischen Himmel und Hölle, zwischen Meer und Meer; Mutter zwischen Wiesen und Watt, zwischen Teich und Strom; Engel zwischen Wachen und Schlaf, zwischen Nebel und Wind: Hamburg!
KEB: Herr Borchert, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Heizung mit Steinkohlen überall
Kurt E. Becker im Gespräch mit James Fenimore Cooper
Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021
Schickt einen Philosophen nach London
Kurt E. Becker im Gespräch mit Heinrich Heine
Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021

Reiseandenken wie in Mariazell
Kurt E. Becker im Gespräch mit Egon Erwin Kisch
Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021
Enge, krumme, stinkende Straßen
Kurt E. Becker im Gespräch mit Heinrich von Kleist
Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021
Rom ist ganz Hof und Adel
Kurt E. Becker im Gespräch mit Michel de Montaigne
KEB: Während Ihrer Zeit in Rom hatten Sie auch die Hafenstadt Ostia besucht. Was waren Ihre Eindrücke auf der Rückfahrt nach Rom?

Montaigne: Die Straße von Ostia nach Rom, die via ostiensis, ist reich an Spuren ihrer einstigen Schönheit: Dammaufschüttungen in großer Zahl, viele Überreste der alten Aquaedukte und mächtige Bauruinen, die fast die ganze Strecke säumen; Zweidrittel davon sind zudem noch mit jenen schwarzen Steinplatten gepflastert, die den Römern als Straßenbelag dienten.
KEB: Interessante Mutmaßungen, die Sie im Übrigen auf Ihrer Fahrt anstellen!
Montaigne: Wenn man dieses Ufer des Tiber sieht, leuchtet einem die Mutmaßung ohne weiteres ein, dass ehedem Wohnbauten die Straße auf beiden Seiten eingerahmt hätten, von Rom bis Ostia. Unter den Ruinen fiel uns etwa auf halbem Weg zur Linken das sehr schöne Grabmal eines römischen Prätors auf, dessen Inschrift noch völlig erhalten ist.
KEB: Und das altertümliche Rom, wie wir es heute kennen, was waren Ihre Eindrücke?
Montaigne: Die Ruinen in Rom selbst hingegen bestehn meist nur noch aus den wuchtigen Überresten jener Mauern aus Ziegelstein, die ursprünglich mit Platten aus Marmor, mit einem andren weißen Stein, mit einem bestimmten Putz oder mit von diesem überdeckten großen viereckigen Tafeln verkleidet waren. Der Lauf der Zeit hat diese Verkleidungen fast überall längst versetzt; gerade auf ihnen aber standen die Inschriften. So ging uns deren Kenntnis in den meisten Fällen verloren. Nur da blieben sie erhalten, wo der Bau aus massiven Quadersteinen bestand.
KEB: Spannend auch Ihre Mutmaßungen über die Römer bei der Fahrt gen Rom!?
Montaigne: Sobald man sich Rom nähert, sieht man fast ausschließlich kahles und unbebautes Land, sei es, weil die Natur keine Kultivierung zulässt, sei es, was ich wahrscheinlicher finde, weil diese Stadt kaum Menschen hat, die von ihrer Hände Arbeit leben.
KEB: Mit interessanten Schlussfolgerungen…
Montaigne: Dieses Rom ist ganz Hof und Adel: Jeder nimmt auf seine Weise am klerikalen Nichtstun teil. Es gibt keinerlei Geschäftsstraße, wo man etwas kaufen könnte, und wenn doch einmal, dann ist sie wie im kleinsten Nest. Nur Paläste und Gärten... Die Stadt ändert kaum jemals ihr Gesicht, ob Werk- oder Feiertag.
KEB: …die Sie vielleicht auch zu einem Aphorismus in einem Ihrer Essays inspiriert haben…
Montaigne: …der Geist, vom Müßiggang verwirrt, zum ruhelosen Irrlicht wird…Wie ein durchgegangnes Pferd macht er (der Geist, KEB), sich selber heute hundertmal mehr zu schaffen als zuvor, da er für andere tätig war; und er gebiert mir soviel Schimären und phantastische Ungeheuer, immer neue, ohne Sinn und Verstand, dass ich, um ihre Abwegigkeit und Rätselhaftigkeit mir mit Gelassenheit betrachten zu können, über sie Buch zu führen begonnen habe. So hoffe ich, ihn mit der Zeit dahin zu bringen, dass er selbst sich ihrer schämt…
KEB: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Menschenunwürdige Mietskasernen
Kurt E. Becker im Gespräch mit Carl von Ossietzky
Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021
Heidelberg: Feierlich groß die Schlossruine
Kurt E. Becker im Gespräch mit Gustav Schwab
KEB: Herr Schwab, lassen Sie uns über die Universitätsstadt am Neckar miteinander sprechen.
Schwab: Stadt und Schloss Heidelberg liegen in dem engen Tale, in welches hier, wenige Stunden vor seiner Mündung, der Neckarstrom, einem ungeheuren Waldbache ähnlich, durch die hohen Granit- und Sandsteinwände links des großen, rechts des kleinen Odenwaldes hineingezwängt wird; die Stadt so tief, dass sie des Schauspiels der aufgehenden Sonne entbehren muss; das Schloss am Fuße des Königsstuhles, des erhabensten Berges nächster Umgegend, auf Granitfels, 613 Fuß über dem Meere, 313 über dem Flusse. Das sich zersetzende granitische Gestein ist dem Pflanzenwachstume besonders günstig; daher die prächtigen Gruppen kraftvoller Bäume und der wohltuende Wechsel mannichfaltiger Schattierungen von Laub- und Nadelholz, der Efeu gedeiht auf dem Schlosse mit seltener Üppigkeit; große Trümmermassen der alten Feste werden von Efeu umschlungen und gleichsam zusammengehalten. Zunächst über dem Schlosse grünen saftige Kastanienwälder, und in dem ganzen Tale ist die Vegetation des Nordens und des Südens zauberisch ineinander verwoben.
KEB: Einige Heidelberger Besonderheiten, vielleicht?
Schwab: Den schönsten Standpunkt für einen Überblick der Stadt und der weiten Rheinebene bis über Mannheim hinaus, zu der blauen Vogesenkette, gewährt … in der Nähe des „Dicken Turmes“der „Große Wall“, später der „Stückgarten“ genannt …
Unter den öffentlichen Gebäuden ruht unser Auge mit besonderem Interesse auf der ältesten Kirche der Stadt, zu St. Peter, wo Hieronymus von Prag, der treue Gefährte des berühmten Hus, 1406 seine Thesen anschlug und auf dem nahen Totenhofe vor versammeltem Volke verteidigte … Geschichtlich merkwürdig ist auch die Kirche zum Heiligen Geist, die Hauptpfarrkirche der Stadt, an der drei Fürsten bauten, die in ihren dunkeln Schoß ganze Geschlechter alter Pfalzgrafen und Kurfürsten aufgenommen hatte …
Von den Toren zeichnet sich das auf die Neckargmünder Straße führende … luxuriöse Karlstor aus, das im Jahr 1775 mit großer Verschwendung städtischer Gelder aufgeführt wurde. Die schöne Neckarbrücke ist neu … 700 Fuß lang und 30 breit, … 1786–1788 gebaut … sie gewährt einen herrlichen Standpunkt, zumal für das Schauspiel der untergehenden Sonne, wo die niedern Berge schon in Dunkel gehüllt sind, die Höhen noch von lebhaftem Lichte strahlen, der Neckar im Purpur der Abendröte glüht, das ferne Haardt-Gebirge wie mit Gold überdeckt erscheint und aus der Mitte der Landschaft düster und feierlich groß die Schlossruine sich erhebt.
KEB: Auch dem Tourismus war die alte Universitätsstadt nie abgeneigt. Immerhin hat Max Weber, und viele andere Gelehrte auch, auf dem Bergfriedhof seine letzte Ruhestätte gefunden.
Schwab: Noch vereinigt die kleine Stadt, deren lange, belebte, mit schmucken Kauf- und Kramläden prangende Hauptstraße an das große Paris erinnert, aus wissenschaftlichem und anderem Gebiete vieles Denk- und Sehenswürdige. Die Universität … besitzt einen Kreis der berühmtesten Lehrer und Gelehrten Deutschlands. Ein schönes Museum ladet zur Geselligkeit ein; viele Fremde, besonders Engländer, haben ihren längern oder kürzern Wohnsitz in der freundlichen Neckarstadt aufgeschlagen…
KEB: Ich danke für dieses Gespräch.
Wie eine losgerissene Blüte im Meere
Kurt E. Becker im Gespräch mit Georg Simmel über Venedig
KEB: Für unser heutiges Gespräch lassen Sie uns nach Venedig schauen Herr Simmel. Und schauen wir zunächst auf die venezianische Baukunst, jenes universell prägende Phänomen herstellend menschlichen Hausens.
Simmel: Die venezianischen Paläste … sind ein preziöses Spiel, schon durch ihre Gleichmäßigkeit die individuellen Charaktere ihrer Menschen maskierend, ein Schleier, dessen Falten nur den Gesetzen seiner eigenen Schönheit folgen und das Leben hinter ihm nur dadurch verraten, dass sie es verhüllen. Jedes innerlich wahre Kunstwerk, so phantastisch und subjektiv es sei, spricht irgendeine Art und Weise aus, auf die das Leben möglich ist. Fährt man aber den Canale Grande entlang, so weiß man: Wie das Leben auch sei – so jedenfalls kann es nicht sein. Hier, am Markusplatz, auf der Piazzetta, empfindet man einen eisernen Machtwillen, eine finstre Leidenschaft, die wie das Ding an sich hinter dieser heitern Erscheinung stehn: aber die Erscheinung lebt wie in ostentativer Abtrennung vom Sein, die Außenseite erhält von ihrer Innenseite keinerlei Direktive und Nahrung, sie gehorcht nicht dem Gesetz einer übergreifenden seelischen Wirklichkeit, sondern dem einer Kunst, das jenes gerade zu dementieren bestimmt scheint. Indem aber hinter der Kunst, so vollendet sie in sich sei, der Lebenssinn verschwunden ist oder in entgegengesetzter Richtung läuft, wird sie zur Künstlichkeit … Venedig … ist die künstliche Stadt.
KEB: Sie sprechen von lügenhafter Schönheit und Maske. Was hat es damit in Venedig auf sich?
Simmel: … Wo all das Heitere und Helle, das Leichte und Freie, nur einem finstern, gewalttätigen, unerbittlich zweckmäßigen Leben zur Fassade diente, da hat dessen Untergang nur ein entseeltes Bühnenbild, nur die lügenhafte Schönheit der Maske übrig gelassen. Alle Menschen in Venedig gehen wie über die Bühne: in ihrer Geschäftigkeit, mit der nichts geschafft wird, oder mit ihrer leeren Träumerei tauchen sie fortwährend um eine Ecke herum auf und verschwinden sogleich hinter einer andern und haben dabei immer etwas wie Schauspieler, die rechts und links von der Szene nichts sind, das Spiel geht nur dort vor und ist ohne Ursache in der Realität des Vorher, ohne Wirkung in der Realität des Nachher.
Wie sie gehn und stehn, kaufen und verkaufen, betrachten und reden – alles das erscheint uns, sobald uns das Sein dieser Stadt, das in der Ablösung des Scheins vom Sein besteht, einmal in seinem Bann hat, als etwas nur Zweidimensionales, wie aufgeklebt auf das Wirkliche und Definitive ihres Wesens. Aber als habe sich dieses Wesen darunter verzehrt, ist alles Tun ein Davor, das kein Dahinter hat, eine Seite einer Gleichung, deren andere ausgelöscht ist.
KEB: Welch grandiose Beschreibung und scharfsichtige Analyse der Wechselwirkung einer Stadtarchitektur mit dem Verhalten der Menschen! Mehr davon, bitte, die Stadtarchitektur vielleicht im Wechsel der Zeiten beschreibend.
Simmel: Selbst die Brücke verliert hier ihre verlebendigende Kraft. Sie leistet sonst das Unvergleichliche, die Spannung und die Versöhnung zwischen den Raumpunkten wie mit einem Schlage zu bewirken, zwischen ihnen sich bewegend, ihre Getrenntheit und ihre Verbundenheit als eines und dasselbe fühlbar zu machen. Diese Doppelfunktion aber, die der bloß malerischen Erscheinung der Brücke eine tiefer bedeutsame Lebendigkeit unterlegt, ist hier verblasst, die Gassen gleiten wie absatzlos über die unzähligen Brücken hinweg, so hoch sich der Brückenbogen spannt, es ist nur wie ein Aufatmen der Gasse, das ihren kontinuierlichen Gang nicht unterbricht. Und ganz ebenso gleiten die Jahreszeiten durch diese Stadt, ohne dass der Wandel vom Winter zum Frühling, vom Sommer zum Herbst ihr Bild merklich änderten. Sonst spüren wir doch an der blühenden und welkenden Vegetation eine Wurzel, die an den wechselnden Reaktionen auf den Wechsel der Zeiten ihre Lebendigkeit erweist. Venedig aber ist dem von innen her fremd, das Grün seiner spärlichen Gärten, das irgendwo in Stein oder in Luft zu wurzeln oder nicht zu wurzeln scheint, ist dem Wechsel wie entzogen. Als hätten alle Dinge alle Schönheit, die sie hergeben können, an ihrer Oberfläche gesammelt und sich dann von ihr zurückgezogen, so dass sie nun wie erstarrt diese Schönheit hütet, die die Lebendigkeit und Entwicklung des wirklichen Seins nicht mehr mitmacht.
Es gibt wahrscheinlich keine Stadt, deren Leben sich so ganz und gar in einem Tempo vollzieht. Keinerlei Zugtiere oder Fahrzeuge reißen das verfolgende Auge in wechselnde Schnelligkeiten mit, die Gondeln haben durchaus das Tempo und den Rhythmus gehender Menschen. Und dies ist die eigentliche Ursache des „traumhaften“ Charakters von Venedig, den man von je empfunden hat.
KEB: Ein Wort mehr zum „traumhaften“ Charakter der Lagunenstadt, nicht zuletzt auch Ort der Inspiration etwa für Thomas Mann.
Simmel: Die Monotonie aller venezianischen Rhythmen versagt uns die Aufrüttelungen und Anstöße, deren es für das Gefühl der vollen Wirklichkeit bedarf, und nähert uns dem Traum, in dem uns der Schein der Dinge umgibt, ohne die Dinge selbst. Ihrer eignen Gesetzlichkeit nach erzeugt die Seele, in dem Rhythmus dieser Stadt befangen, in sich die gleiche Stimmung, die ihr ästhetisches Bild in der Form der Objektivität bietet: als atmeten nur noch die obersten, bloß spiegelnden, bloß genießenden Schichten der Seele, während ihre volle Wirklichkeit wie in einem lässigen Traum abseits steht. Aber indem nun diese, von den Substanzen und Bewegtheiten des wahren Lebens gelösten Inhalte hier dennoch unser Leben ausmachen, bekommt dieses von innen her teil an der Lüge von Venedig.
KEB: Herr Simmel, ich danke Ihnen auf das Herzlichste für dieses Gespräch.
Das Glück der ganz reifen Menschen
Kurt E. Becker im Gespräch mit Georg Simmel über Florenz
KEB: Herr Simmel, in Florenz entdecken Sie eine ganz besondere Konstellation des Behaust-Seins: In der Stadt am Arno sei der Gegensatz von Natur und Geist nichtig geworden, so Ihre Einsicht.
Simmel: Eine geheimnisvolle und doch wie mit Augen zu sehende, mit Händen zu greifende Einheit webt die Landschaft, den Duft ihres Bodens und das Leben ihrer Linien mit dem Geist, der ihre Frucht ist, zusammen mit der Geschichte des europäischen Menschen, der hier seine Form gewann, mit der Kunst, die hier wie ein Bodenprodukt wirkt. Man begreift, dass an dieser Stelle die Renaissance entstanden ist, das erste Gefühl, dass alle Schönheit und Bedeutsamkeit, die die Kunst sucht, sich als eine Herausbildung aus der natürlich gegebenen Erscheinung der Dinge einstellt, und dass die Renaissancekünstler, auch die der souveränsten Stilisierung, meinen durften, sie schrieben nur die Natur ab. Hier ist die Natur Geist geworden, ohne sich selbst aufzugeben. Jeder dieser Hügel symbolisiert die Einheit, in der die Gegensätze des Lebens zu Geschwistern werden: in dem jeder sich zu einer Villa, einer Kirche erhebt, scheint die Natur überall auf die Krönung durch den Geist hinzuwachsen.
KEB: Eine wunderbare Beschreibung der Toskana und ihrer „Hauptstadt“…
Simmel: Es gibt vielleicht keine zweite Stadt, deren Gesamteindruck, ihr Anschauliches und ihre Erinnerungen, ihre Natur und ihre Kultur zusammenwirkend, in dem Beschauer so stark den Eindruck des Kunstwerks erzeugte, bis in das Äußerlichste hin: Auch die kahlen Berge hinter Fiesole, die nicht wie alle näheren Hügel die Zeichen menschlicher Tätigkeit tragen, wirken gerade nur wie die Einfassung des durch den Geist und die Kultur charakterisierten Bildes und werden so in dessen Gesamtcharakter hineingezogen wie der Rahmen in das Gemälde, dessen Sinne er gerade durch sein Anderssein dient, weil er es damit als einen für sich bestehenden, sich selbst genügenden Organismus zusammenschließt.
KEB: Unter anderem schrieben Sie in diesem Zusammenhang vom „Glück der ganz reifen Menschen“. Was genau wollen Sie uns damit sagen?
Simmel: Es ist, als suchte diese Stadt aus allen Winkeln der Seele alles Reife, Heitere, Lebensvolle zusammen und bildete daraus ein Ganzes, indem sie plötzlich den inneren Zusammenhang und Einheit davon fühlbar macht …
Die inneren Grenzen von Florenz sind die Grenzen der Kunst. Die Erde von Florenz ist keine, auf die man sich niederwirft, um das Herz des Daseins in seiner dunklen Wärme, seiner ungeformten Stärke schlagen zu fühlen – wie wir es im deutschen Wald und am Meer und selbst in irgendeinem Blumengärtchen einer namenlosen Kleinstadt spüren können. Darum ist Florenz kein Boden für uns in Epochen, in denen man noch einmal von vorn anfangen, sich noch einmal den Quellen des Lebens gegenüberstellen will, wo man aus den Wirrnissen der Seele sich an dem ganz ursprünglichen Dasein orientieren muss. Florenz ist das Glück der ganz reifen Menschen, die das Wesentliche des Lebens errungen oder darauf verzichtet haben und für diesen Besitz oder diesen Verzicht nur noch seine Form suchen wollen … Florenz wirkt wie ein Werk der Kunst, weil sein Bildcharakter mit einem zwar historisch verschwundenen, aber ideell ihm getreu einwohnenden Leben verbunden ist … Florenz kann nie zur bloßen Maske werden, weil seine Erscheinung die unverstellte Sprache eines wirklichen Lebens war … So ist Florenz, das der Seele die herrlich eindeutige Sicherheit einer Heimat gibt …
KEB: Herr Simmel, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Hier sollte man… hier müsste man…
Kurt E. Becker im Gespräch mit Kurt Tucholsky
KEB: Herr Tucholsky, lassen Sie uns heute nicht über Paris, Berlin oder sonst eine Metropole miteinander sprechen, sondern über die kleinen Städte am Main und am Neckar. In diesen bezaubernden Flusstälern erleben wir eine ganz besondere Art menschlichen Behaustseins, wie Sie uns wissen lassen.
Tucholsky: Wer Spessart und Odenwald … zu Fuß durchwandern will, … wird drei Schönheiten in sich aufnehmen können: den Wald, den Wein und die kleinen Städte …
KEB: Konzentrieren wir uns auf die kleinen Städte, was hat es mit denen auf sich?
Tucholsky: Diese kleinen Städte – am Main und am Neckar – sind in jeder Jahreszeit schön, am schönsten aber im Herbst, wenn die Luft klar über den alten Dächern steht und die Architektur sich scharf gegen den hellen Himmel abhebt. Wundervoll, wie Fluss und Landschaft fast immer zusammenstehen, wie organisch so ein Städtchen um den Fluss herum und an ihm entlang gewachsen ist, so dass sich das breite Flussbett mühelos in das Bild einordnet. Selten nur stört ein Fabrikschornstein oder ein verständnislos angelegtes Gebäude den Gesamtaspekt, den man nicht: „malerisch“ nennen sollte, sondern: „natürlich“ – die Städtchen sind in diese Natur hineingewachsen, gehören ihr einfach an und bilden mit ihr ein Ganzes. So am Neckar, so die alten kleinen Orte am Main, die noch oft ihren alten Charakter voll bewahrt haben.
KEB: Was ist Ihr Tipp für den Reisenden, der dieses Idyll erfahren oder erwandern möchte?
Tucholsky: Man laufe keinen echten oder eingebildeten „Sehenswürdigkeiten“ nach, sondern lasse die Musik dieser süddeutschen Landschaft auf sich wirken wie einen Orgelklang. Wer sich vor der Reise in ein paar Landschaften Dürers versenkt, tut vielleicht mehr für eine gute Vorbereitung als der emsige Geschichtsjäger mit dem Führer in der Hand; es gibt ja Reisende, bei denen man das Gefühl nicht loswird, dass sie nur ausziehen, um zu sehen, ob auch noch alles da ist …
KEB: Was ist das Besondere an dieser Gegend?
Tucholsky: … sie ist, fast möchte ich sagen, gelassen, menschliche Ansiedlungen sind der Natur nicht abgerungen, sondern ruhen friedfertig im Grünen; bei allem Fleiß der Bevölkerung ist etwas Leichtes in der Luft, die Sorgen wiegen, scheints, nicht so schwer, und jeder freut sich, dass er auf der Welt ist.
KEB: Auf ein Idyll weisen Sie ganz besonders hin!
Tucholsky: Kloster Bronnbach ist wie eine Fermate an Stille, nicht einmal der nahe Eisenbahndamm kann uns stören, Klosterhof und berankte Mauer atmen Ruhe und Beschaulichkeit; es sind das jene Flecken, die in jedem Großstädter unweigerlich den Wunsch erwecken: Hier sollte man … hier müsste man … und dann geht man weiter.
KEB: Herr Tucholsky, ich danke Ihnen für dieses eindrückliche Gespräch.
Spießbürgerliche Gesinnung
Kurt E. Becker im Gespräch mit Voltaire
Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021
Sklavenkultur
Kurt E. Becker im Gespräch mit Max Weber
KEB: Herr Professor Weber, lassen Sie uns über die Kultur des Altertums miteinander sprechen. Die hatten Sie selbst ihrem Wesen nach als „städtische“ Kultur charakterisiert. Was heißt das?
Weber: Die Stadt ist Trägerin des politischen Lebens wie der Kunst und Literatur. Auch ökonomisch eignet, wenigstens in der historischen Frühzeit, dem Altertum diejenige Wirtschaftsform, die wir heute „Stadtwirtschaft“ zu nennen pflegen.
KEB: Was können wir unter „Stadtwirtschaft“ verstehen?
Weber: Die Stadt des Altertums ist in hellenischer Zeit nicht wesentlich verschieden von der Stadt des Mittelalters. Soweit sie verschieden ist, handelt es sich um Unterschiede von Klima und Rasse des Mittelmeers gegen diejenigen Zentraleuropas, ähnlich wie noch jetzt englische und italienische Arbeiter und deutsche und italienische Handwerker sich unterscheiden. Ökonomisch ruht auch die antike Stadt ursprünglich auf dem Austausch der Produkte des städtischen Gewerbes mit den Erzeugnissen eines engen ländlichen Umkreises auf dem städtischen Markt. Dieser Austausch unmittelbar vom Produzenten zum Konsumenten deckt im Wesentlichen den Bedarf, ohne Zufuhr von außen.
KEB: Mit der städtischen Kultur im Altertum hatte es darüber hinaus in zahlreichen Einzelfällen eine besondere Bewandtnis.
Weber: Die Kultur des europäischen Altertums ist Küstenkultur, wie seine Geschichte zunächst Geschichte von Küstenstädten. Neben dem technisch fein durchgebildeten städtischen Verkehr steht schroff die Naturalwirtschaft der barbarischen Bauern des Binnenlandes, in Gaugenossenschaften oder unter der Herrschaft feudaler Patriarchen gebunden. Nur über See oder auf großen Strömen vollzieht sich wirklich dauernd und stetig ein internationaler Verkehr. Ein Binnenverkehr, der sich auch nur mit dem des Mittelalters vergleichen ließe, existiert im europäischen Altertum nicht. Die vielgepriesenen römischen Straßen sind so wenig Träger eines auch nur entfernt an neuere Verhältnisse erinnernden Verkehrs wie die römische Post. Ungeheuer sind die Unterschiede in der Rentabilität von Binnengütern gegen solche an Wasserstraßen. Die Nachbarschaft der Landstraßen der römischen Zeit galt im Altertum im Allgemeinen nicht als Vorteil, sondern als Plage, der Einquartierung und – des Ungeziefers wegen: Sie sind Militär- und nicht Verkehrsstraßen.
KEB: Noch eine weitere, für uns Heutige völlig unvorstellbare Besonderheit, beherrscht die antike Kultur und exemplifiziert menschliches Hausen der übelsten Art auf unserem Planeten …
Weber: Die antike Kultur ist Sklavenkultur. Von Anfang an steht neben der freien Arbeit der Stadt die unfreie des platten Landes, neben der freien Arbeitsteilung durch Tauschverkehr auf dem städtischen Markt die unfreie Arbeitsteilung durch Organisation der eigenwirtschaftlichen Gütererzeugung im ländlichen Gutshof – wiederum wie im Mittelalter.
KEB: Die „Beschaffung“ der „Arbeitskräfte“ hatte immer eine besondere Qualität …
Weber: Der Krieg des Altertums ist zugleich Sklavenjagd; er bringt fortgesetzt Material auf den Sklavenmarkt und begünstigt so in unerhörter Weise die unfreie Arbeit und die Menschenanhäufung. Damit wurde das freie Gewerbe zum Stillstand auf der Stufe der besitzlosen Kunden-Lohnarbeit verurteilt. Es wurde verhindert, dass mit Entwicklung der Konkurrenz freier Unternehmer mit freier Lohnarbeit um den Absatz auf dem Markt diejenige ökonomische Prämie auf arbeitsparende Erfindungen entstand, welche die letzteren in der Neuzeit hervorrief. Hingegen schwillt im Altertum unausgesetzt das ökonomische Schwergewicht der unfreien Arbeit im „Oikos“. Nur die Sklavenbesitzer vermögen ihren Bedarf arbeitsteilig durch Sklavenarbeit zu versorgen und in ihrer Lebenshaltung aufzusteigen. Nur der Sklavenbetrieb vermag neben der Deckung des eigenen Bedarfs zunehmend für den Markt zu produzieren.
KEB: Herr Professor Weber, ich danke für dieses überaus bedrückend erhellende Gespräch.
Kultur schaffen und verteidigen
Kurt E. Becker im Gespräch mit Stefan Zweig
Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021